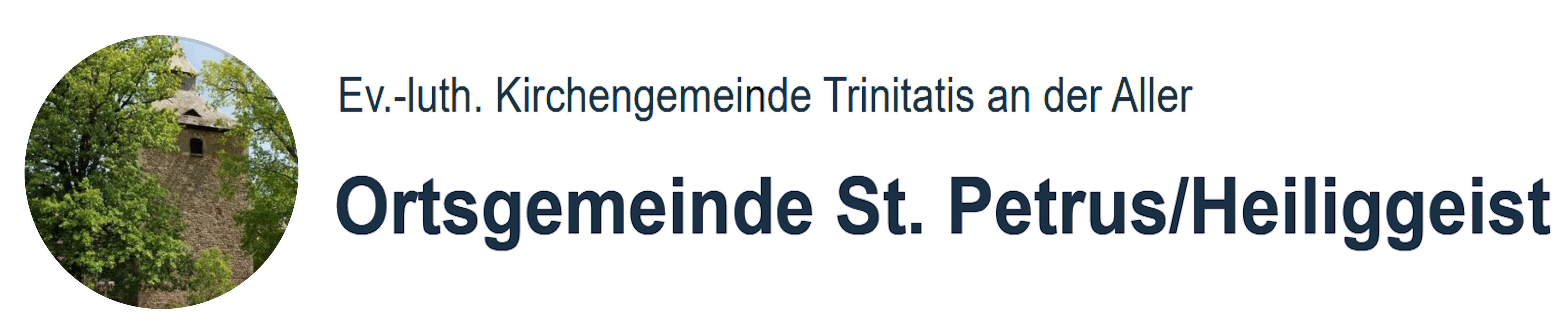St. Petrus-Kirche
Das im Ortszentrum gelegene Gotteshaus ist unter den Wolfsburger Kirchen das größte Gebäude mit mittelalterlicher Bausubstanz. Es entstand als einschiffige Saalkirche mit einem querrechteckigen Turm. Ein großer Teil des heute vorhandenen Bauwerkes aus gebrochenem Sandstein stammt aus dem 13. Jahrhundert.
Der ursprünglich etwas 12 Meter hohe Kirchturm als ältestes Bauteil könnte anfangs auch als Wehrkirche oder Schutzturm gedient haben. Er hat eine massive Bauweise mit zwei Meter starken Wänden und kleinen Fensteröffnungen. Die Feuersbrunst in der Neujahrsnacht 1604/05 zerstörte auch die Kirche erheblich. Der Dreißigjährige Krieg verhinderte Reparaturen und erst 1699 war das Gotteshaus wieder hergerichtet.
Bei einer Bauerweiterung 1749 erhielt die Kirche das heutige Aussehen mit einer Turmhöhe von 25 Meter und einer Vergrößerung des Innenraums durch ein Querschiff.
In der Glockenstube des Kirchturms befinden sich drei Glocken aus dem Jahre 1924.
Die große Glocke hat einen Durchmesser von 1,96 m. Sie heißt GLAUBE und trägt die Inschrift "Welchen der Herr lieb hat züchtigt er" (Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 6) und "Der grosse Krieg verschlang; die vor mir hier hang". Die mittlere Glocke (1,67 m) heißt LIEBE und auf ihr steht: "Niemand hat grössere Liebe denn die dass er sein Leben lasset für seine Freunde" (Johannesevangelium Kapitel 15, Vers 13) und "Den im Weltkriege 1914-1918 gefallenen zum Gedächtnis". Die kleinste Glocke umfasst 1,40 m und heißt HOFFNUNG. Auf ihr ist zu lesen: "Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten" (Psalm 126, Vers 5) sowie "Mit hellem, hehrem Munde ruf ich zur Andachtsstunde".
Schon 1475 wurde St. Petrus Patronatskirche des auf der Wolfsburg herrschenden Adelsgeschlechtes derer von Bartensleben, die mit Ort und Kirche aufs engste verbunden waren. Unter dem Kirchenboden sind im 16. Jahrhundert acht ihrer Angehörigen bestattet worden, darunter Hans der Reiche. In der Gruft ruhen seit dem 17. Jahrhundert 13 ihrer Familienmitglieder in prunkvollen Holzsärgen.
Aus der ehemaligen Patronatsfamilie sind vier Grabsteine erhalten. Auf farbig gestalteten Bildnisgrabsteinen beiderseits des Chorbogens werden in Lebensgröße Günter von Bartensleben (1558-1597) und dessen Ehefrau Sophie geb. von Veltheim (1574-1613) dargestellt.
An der Innenausstattung sind besonders der steinerne Altar und der barocke Kanzelaufbau (1750) erwähnenswert. Diese Kanzel betont insbesondere die Hochschätzung der Predigt seit der Reformation. Der Kanzelkorb wird von einem Giebel mit Kreuz überfangen.
Im Chorraum steht ein kelchförmiger Taufstein aus der Renaissance (um 1600). Auf den sechs Seitenflächen des Beckens sind Reliefs der vier Evangelisten sowie Darstellungen der Sintflut und der Taufe Jesu im Jordan zu erkennen.
In zwei Ölgemälden sind im südlichen Querhausarm überlebensgroße Porträts des Reformators Dr. Martin Luther (1483-1546) und seines Freundes Philipp Melanchton (1497-1560) angebracht. Die Bilder sind Kopien nach Darstellungen des Malers Lucas Cranach d. Ä. (1472-1553) und wurden 1866 der Kirchengemeinde gestiftet.